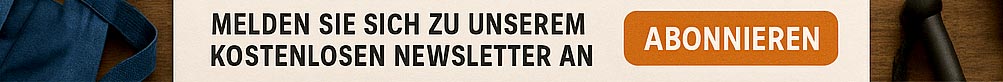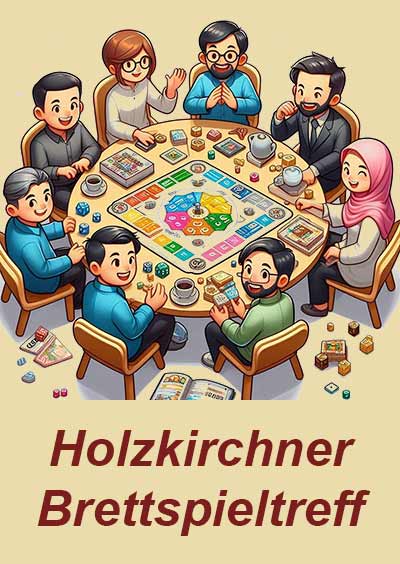Gefühlt darf man draußen aus rechtlicher Sicht überhaupt nichts mehr: Kein Feuer machen, kein Übernachten unter freiem Himmel, die Wege nicht verlassen. Oft stehen im Wald Bauten, die an Indianertipis aus Totholz erinnern – dürfen Kinder heute noch Buden bauen? Und sogar das Mitführen eines Schweizer Taschenmessers soll mittlerweile verboten sein. Heißt das am Ende, dass man beim Picknick den Käse am Stück essen muss oder dass man keinen Ast mehr als Spazierstock schnitzen darf? – Genau diese Fragen bewegen viele Naturfreunde. Ein genauer Blick in die Gesetze zeigt: Ganz so restriktiv ist es nicht, aber die Regelungen sind differenziert und hängen stark vom Ort und Zweck ab.
Feuer machen
Offenes Feuer ist im und im Umkreis von 100 Metern um den Wald in Bayern grundsätzlich untersagt. Dieses Verbot gilt nicht nur für große Lagerfeuer, sondern auch für kleinere Feuerstellen, Grillfeuer oder jede Form von „unverwahrter Glut“. Mit „unverwahrt“ ist gemeint, dass die Glut nicht vollständig gesichert, überwacht und kontrolliert wird – also beispielsweise ein noch glimmender Rest im Boden, eine nicht vollständig gelöschte Grillstelle oder Funkenflug aus einem offenen Feuer. Schon kleinste Glutreste können bei Trockenheit einen Waldbrand auslösen.
Erlaubt sind Feuer ausschließlich an offiziell ausgewiesenen und entsprechend gesicherten Feuerstellen oder wenn die zuständige Behörde ausdrücklich eine Genehmigung erteilt. Spontane Feuer im Wald oder am Waldrand sind damit immer tabu – auch wenn sie klein wirken oder nur kurz brennen sollen.
Übernachten in der Natur
Campieren mit Zelt, Plane oder offenem Biwak ist überall in Deutschland grundsätzlich nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Grundstückseigentümers oder -verwalters gestattet. Der Grund: Ein Übernachten beispielsweise im Wald gilt rechtlich als „Sondernutzung“ und nicht mehr nur als bloßes Betreten der Natur. Ausnahmen gibt es lediglich in echten Notlagen, wenn also ein sogenanntes Not-Biwak unvermeidbar ist – etwa bei plötzlichem Unwetter, Verletzungen oder einbrechender Dunkelheit, wenn der Rückweg nicht mehr gefahrlos möglich ist. Dieses kurzfristige Lagern wird im Sinne der Gefahrenabwehr geduldet und nicht als Ordnungswidrigkeit verfolgt.
Für alle, die bewusst draußen übernachten möchten, gibt es inzwischen legale Alternativen: In vielen Regionen wurden sogenannte Trekkingplätze eingerichtet. Diese sind einfache, naturnahe Übernachtungsplätze, oft nur mit einer Plattform oder Feuerstelle ausgestattet, die gegen eine geringe Gebühr online gebucht werden können. Dort ist das Übernachten mit Zelt oder Biwak ausdrücklich erlaubt – meist für eine Nacht und in begrenzter Personenzahl. Auf diese Weise lässt sich das Abenteuer „Schlafen unter freiem Himmel“ erleben, ohne gegen Naturschutz- oder Eigentumsrechte zu verstoßen.
Wege verlassen
Bayern räumt Fußgängern ein im bundesweiten Vergleich sehr weitreichendes Betretungsrecht ein. Nach Artikel 27 des Bayerischen Naturschutzgesetzes dürfen Menschen den Wald und die freie Natur grundsätzlich zu Erholungszwecken betreten – und das ausdrücklich nicht nur auf Wegen. Das heißt: Spaziergänge querfeldein, das Suchen von Pilzen oder das Erkunden abseits befestigter Pfade sind im Normalfall erlaubt, solange man sich rücksichtsvoll verhält und keine Schäden anrichtet. Dieses Recht ist sogar verfassungsrechtlich abgesichert und wird in Bayern traditionell sehr hochgehalten.
Allerdings ist das Betretungsrecht nicht grenzenlos: In bestimmten Schutzgebieten, etwa im Nationalpark Bayerischer Wald, in Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebieten, gelten klare Einschränkungen. Dort können Wegegebote vorgeschrieben sein, um sensible Tier- und Pflanzenarten zu schützen. Ebenso dürfen Flächen gesperrt werden – zum Beispiel aus Gründen der Forstwirtschaft, bei Jagden, während besonderer Brutzeiten oder nach Sturmschäden. Diese Sperren müssen jedoch deutlich erkennbar gemacht werden, etwa durch Schilder oder Absperrungen.
In der Praxis bedeutet das: Wer sich außerhalb von Schutzgebieten bewegt und keine Sperrhinweise ignoriert, darf sich in Bayern auch abseits der Wege frei im Wald aufhalten. Rücksicht auf Wildtiere, Pflanzen und die Belange der Waldbesitzer bleibt dabei aber oberstes Gebot.
Geocaching
Das Suchen von Geocaches ist vom Betretungsrecht gedeckt, solange Rücksicht genommen und Schutzgebietsregeln beachtet werden. Das Verstecken eines Caches ist dagegen eine eigenständige Nutzung und benötigt die Zustimmung des Eigentümers. Im Nationalpark Bayerischer Wald gilt ein Wegegebot (max. drei Meter vom Weg), Nachtcaches sind dort verboten.
Buden aus Totholz
Das Errichten fester Hütten oder dauerhafter Bauwerke im Wald ist in Deutschland generell verboten, da es eine bauliche Nutzung darstellt und sowohl nach dem Baugesetzbuch als auch nach dem Naturschutzrecht einer Genehmigung bedarf. Dazu zählen nicht nur massive Blockhütten oder Schutzhütten, sondern im Grunde jede dauerhafte Struktur, die über das bloße „Spielen“ hinausgeht.
Beliebt bei Kindern sind dagegen kleine Tipis oder Buden, die aus herumliegendem Totholz zusammengestellt werden. Diese Art von Bauwerken bewegt sich in einer rechtlichen Grauzone. In Schutzgebieten wie Natur- oder Nationalparks ist das Budenbauen in aller Regel ausdrücklich untersagt, weil Totholz hier als besonders wertvoller Lebensraum gilt. Viele seltene Arten – etwa Käfer, Pilze, Moose oder Kleinsäuger – sind auf liegendes oder stehendes Totholz angewiesen. Wird dieses Material weggetragen, geschichtet oder gar zerbrochen, kann es seine ökologische Funktion nicht mehr erfüllen.
Außerhalb von Schutzgebieten ist das Budenbauen manchmal geduldet, sofern es sich um kleine, vorübergehende Konstruktionen handelt, die weder Bäume verletzen noch Waldbesucher gefährden. Eltern sollten darauf achten, dass Kinder nur loses Holz vom Boden verwenden und nach dem Spielen alles wieder abbauen. Forstbetriebe und Naturschutzbehörden weisen allerdings regelmäßig darauf hin, dass auch spielerische Bauten im Wald problematisch sein können – sowohl wegen der ökologischen Bedeutung des Totholzes als auch aus Sicherheitsgründen (Umsturzgefahr der aufgestellten Stämme).
Die Empfehlung lautet daher: Budenbau nur in Absprache mit dem Waldbesitzer oder an eigens dafür vorgesehenen Plätzen, und wenn, dann nur klein, temporär und verantwortungsvoll – damit Spiel und Natur im Gleichgewicht bleiben.
Messer
Das deutsche Waffenrecht ist in Bezug auf Messer recht klar geregelt: Das Mitführen von Einhandmessern (also Messern, die sich mit einer Hand öffnen lassen und deren Klinge fest arretierbar ist) sowie von feststehenden Messern mit einer Klingenlänge von mehr als 12 cm ist nach § 42a Waffengesetz verboten, sofern kein „berechtigtes Interesse“ vorliegt. Als berechtigtes Interesse gelten zum Beispiel die Berufsausübung (Handwerker, Jäger, Angler), Brauchtumspflege (z. B. Trachtenbrauchtum) oder der Sport. Für den Freizeitgebrauch im Wald fällt man in der Regel nicht darunter.
Ein klassisches Schweizer Taschenmesser ist dagegen erlaubt. Es lässt sich nur zweihändig öffnen, hat keine feststellbare Klinge und liegt meist bei einer Klingenlänge von 5 bis 9 cm. Damit fällt es nicht unter das Führungsverbot und darf sowohl im Alltag als auch bei Wanderungen im Rucksack oder in der Hosentasche mitgeführt werden. Solche kleinen Messer sind nicht nur beim Schnitzen praktisch, sondern auch beim gemütlichen Picknick: Ein Stück Brot aufschneiden, eine Apfelscheibe vorbereiten oder Käse portionieren – das ist rechtlich völlig unproblematisch.
Was das Sammeln und Verarbeiten von Naturmaterialien betrifft, gilt die sogenannte „Handstraußregelung“ aus dem Bundesnaturschutzgesetz: Jeder darf in kleinen Mengen Pflanzen oder Pflanzenteile für den persönlichen Bedarf nutzen, sofern sie nicht unter besonderem Schutz stehen und das Gebiet keine besonderen Verbote vorsieht. Darunter fällt auch das Aufheben und Bearbeiten von herabgefallenen Ästen. Ein solcher Ast darf geschnitzt, als Wanderstock genutzt oder für kleine Lagerbasteleien verarbeitet werden.
Verboten ist hingegen das Abschneiden oder Abbrechen von frischen Zweigen oder lebenden Ästen, da dies eine Beschädigung des Baumes darstellt. Auch geschützte Arten (z. B. bestimmte Moose, Flechten oder Holzpilze) dürfen nicht entnommen werden. Wer also beim Ausflug im Wald ein Schweizer Taschenmesser zückt, um den Kindern einen Wanderstock anzuspitzen oder Käsewürfel für das Picknick zuzubereiten, bewegt sich völlig im legalen Bereich – solange er sich auf Totholz oder bereits herabgefallene Materialien beschränkt.
Filmen, Fotografieren und Posten in Social Media
Das Filmen oder Fotografieren an sich ist unproblematisch. Aber:
-
Wenn die Handlung selbst verboten ist, kann die Veröffentlichung als Beweis dienen. Beispiel: Ein Video zeigt, wie eine Bude im Naturschutzgebiet gebaut wird – dann könnte die Behörde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten. Bußgelder reichen je nach Verstoß von 50 bis 50.000 Euro.
-
Wenn die Handlung erlaubt oder geduldet ist, gibt es kein Risiko – weder durch Tun noch durch Posten.
-
In der Praxis reagieren Behörden auf Social-Media-Posts eher zurückhaltend, solange keine gravierenden Verstöße dokumentiert werden. Bekannt geworden sind vor allem Fälle mit Drohnenflügen oder illegalen Feuern.
Empfehlung: Beim Posten klarstellen, dass man sich an die Regeln hält („außerhalb von Schutzgebieten“, „mit Zustimmung des Waldbesitzers“). Keine Szenen zeigen, die eindeutig gegen Naturschutzrecht verstoßen könnten.
Fazit
Viele Sorgen entpuppen sich bei näherem Hinsehen als Missverständnis:
-
Feuer: Nein, außer an offiziellen Stellen.
-
Übernachten: Nein, außer mit Erlaubnis oder im Notfall.
-
Wege: Ja, in Bayern grundsätzlich erlaubt – außer in Schutzgebieten.
-
Geocaching: Suchen ja, Verstecken nur mit Genehmigung.
-
Buden: In Schutzgebieten nein, sonst nur eingeschränkt und temporär.
-
Messer/Schnitzen: Schweizer Taschenmesser erlaubt, Einhandmesser verboten; Totholz-Ast schnitzen ja, lebende Bäume beschädigen nein.
-
Posten: Erlaubt – aber Vorsicht, wenn man sich selbst bei einem Verstoß zeigt.
Deutschland – und Bayern im Besonderen – gewährt ein vergleichsweise weitgehendes Betretungsrecht. Wer sich an die Kernregeln hält (kein Feuer, nichts beschädigen, Rücksicht auf Tiere und Pflanzen, Schutzgebietsregeln beachten), wird schnell merken: Draußen ist mehr erlaubt, als man zunächst denkt.