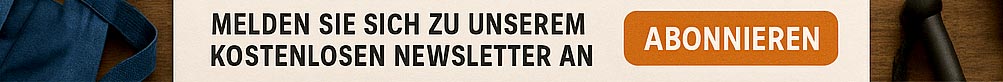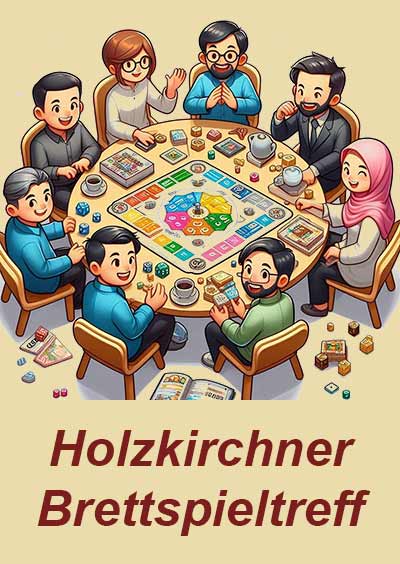Wer in den Alpen wandert, verlässt sich oft auf farbliche Markierungen, um die Schwierigkeit eines Weges einzuschätzen. Doch was auf den ersten Blick einheitlich wirkt, kann in Wahrheit tückisch sein – denn die Einstufungssysteme der Wanderwege sind regional unterschiedlich. Das kann fatale Folgen haben, wenn vermeintlich leichte Routen sich als anspruchsvolle Bergtouren entpuppen.
Die klassische Farbskala: Blau – Rot – Schwarz
Im deutschsprachigen Alpenraum – insbesondere in Deutschland, Österreich und Südtirol – gilt in der Regel folgende Einteilung:
-
Blau (leicht): Gut ausgebaute Wanderwege, meist breit, ohne große Steigungen oder Absturzgefahr. Keine besondere Ausrüstung erforderlich. Geeignet für Anfänger, Familien und Senioren.
-
Rot (mittel): Bergwege mit steileren Passagen, schmalen Pfaden und gelegentlicher Absturzgefahr. Trittsicherheit und gute Kondition sind erforderlich. Möglicherweise kleinere versicherte Stellen oder einfache Kletterpassagen.
-
Schwarz (schwierig): Alpine Steige oder ausgesetzte Bergtouren, oft mit Kletterstellen (UIAA I oder höher), Geröll, Schneefeldern oder fehlender Wegmarkierung. Nur für erfahrene und ausgerüstete Bergsteiger.
Diese Farben orientieren sich grob an den Schwierigkeitsstufen der Alpenvereine (z. B. DAV, ÖAV, AVS). Doch schon innerhalb dieser Regionen kann es zu Abweichungen kommen – etwa bei der Definition von „Schwarz“, was in einem Gebiet eine anspruchsvolle Klettertour bedeutet, in einem anderen jedoch noch als schwieriger Bergweg gilt.
Umgedrehte Farblogik: Die Ausnahmefälle
Besonders gefährlich wird es, wenn die Farblogik auf den Kopf gestellt ist – und das ist in manchen Regionen tatsächlich der Fall. Beispielhaft ist hier die Schweiz, insbesondere in Teilen des Wallis, oder bestimmte Gegenden in Frankreich oder Italien, wo Wanderwege farblich anders eingestuft werden:
-
Keine Farbe oder gelb: einfache Wege, meist im Talbereich, für jedermann geeignet
-
Rot: Bergwanderwege mittlerer Schwierigkeit
-
Blau: alpine Routen mit hoher Schwierigkeit, oft mit Kletterstellen, Schneefeldern oder ohne durchgehende Wegmarkierung
Das kann Wanderer aus Deutschland oder Österreich leicht in die Irre führen: Wer sich auf seine gewohnte Interpretation verlässt und einen blau markierten Weg in der Schweiz wählt, könnte sich plötzlich auf einem ausgesetzten Grat oder in steilem Felsgelände wiederfinden – mit fatalen Folgen.
Warum die Unterschiede?
Die verschiedenen Systeme haben historische und nationale Gründe. In der Schweiz beispielsweise orientiert sich das System der Wanderweg-Kategorisierung an der Schweizer Norm SN 640 829, die Wanderwege in Wanderweg (gelb), Bergwanderweg (weiß-rot-weiß) und Alpinwanderweg (weiß-blau-weiß) unterscheidet. Dabei signalisiert die Farbe nicht nur die Schwierigkeit, sondern auch den notwendigen Ausrüstungsstandard.
In Frankreich wiederum wird oft gar keine Farbkennzeichnung genutzt, sondern die Schwierigkeit über Symbolik, Piktogramme oder erläuternde Beschreibungen auf den Wegweisern angezeigt.
Tipps zur Vermeidung von Fehleinschätzungen
Gerade für weniger erfahrene Wanderer oder Urlauber, die grenzüberschreitend unterwegs sind, kann diese Inkonsistenz gefährlich werden. Folgende Tipps helfen, Fehleinschätzungen zu vermeiden:
-
Vorab informieren: Unbedingt vor der Tour recherchieren, welches Markierungssystem in der Region gilt. Offizielle Tourismusportale, Wanderkarten oder Alpenvereine geben hierzu klare Auskunft.
-
Topografische Karten und Apps nutzen: Karten von Kompass, Alpenverein oder Apps wie Komoot, Outdooractive und Alpenvereinaktiv bieten meist genaue Einstufungen – oft auch mit Höhenprofil, Distanz, Zeitangabe und Erfahrungsberichten.
-
Beschreibung lesen, nicht nur Farbe beachten: Farbmarkierungen allein sagen oft zu wenig. Die Routenbeschreibung – auch online – gibt entscheidende Hinweise zu Trittsicherheit, Ausgesetztheit und Anforderungen.
-
Einschätzung realistisch halten: Eigene Fähigkeiten ehrlich einschätzen. Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und Kondition sind nicht selbstverständlich – und unterschätzte Gefahren wie Wetterumschwünge oder Steinschlag können auch auf „roten“ Wegen lebensgefährlich werden.
-
Nicht allein gehen: Gerade in unbekannten Regionen empfiehlt es sich, mit Begleitung oder im Rahmen einer geführten Tour unterwegs zu sein – zumindest beim ersten Kennenlernen des Geländes.
Fazit
Die Berge sind kein Freizeitpark – sie verlangen Vorbereitung, Respekt und Kenntnis der lokalen Gegebenheiten. Die uneinheitliche Farbkennzeichnung von Wanderwegen in den Alpen ist ein Risiko, das ernst genommen werden sollte. Wer gut vorbereitet ist und weiß, was die Farben in der jeweiligen Region bedeuten, kann sich sicherer bewegen – und die Schönheit der Berge ohne böse Überraschungen genießen.