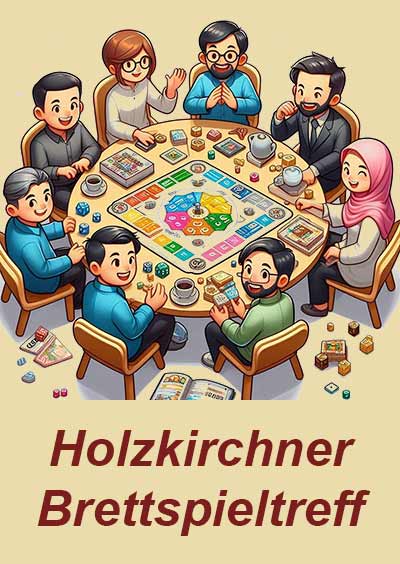Hoch oben, über den Tälern, zwischen Himmel und Stein, steht es – das Gipfelkreuz. Für viele ist es der Höhepunkt einer Wanderung, ein Symbol für das Erreichen eines Ziels. Ein Foto am Gipfelkreuz – das gehört einfach dazu. Doch zunehmend wird aus dem ehrfürchtigen Moment eine selbstverliebte Inszenierung: Menschen klettern auf das Kreuz, hängen sich an die Querstreben, posieren akrobatisch – alles für das perfekte Social-Media-Bild. Was bleibt, ist oft nicht der Moment des Innehaltens, sondern ein Hauch von Respektlosigkeit.
Was ist ein Gipfelkreuz – und warum steht es da?
Ein Gipfelkreuz ist weit mehr als nur ein Stück Holz oder Metall. Es ist ein Symbol – tief verwurzelt in der christlichen Kultur des Alpenraums. Schon im 18. Jahrhundert wurden erste Kreuze auf Bergspitzen errichtet. Manche waren Ausdruck des Glaubens, andere dienten als Dank für die Rückkehr nach überstandenen Gefahren oder als Erinnerung an Verunglückte. Einige wurden zu besonderen Anlässen gestiftet – etwa zur 1000-Jahr-Feier einer Gemeinde oder im Gedenken an einen Krieg oder ein Naturereignis.
Die Menschen, die solche Kreuze errichten, investieren nicht nur Geld, sondern auch Zeit, Überzeugung und Kraft. Oft sind es lokale Bergsteigervereine, Pfarrgemeinden oder Familien, die das Kreuz auf eigene Initiative hin planen, finanzieren, hinauftragen und aufstellen. In schwer zugänglichen Lagen kann das mehrere Tage dauern – und ohne Helikopter kaum zu bewältigen sein. Diese Kreuze stehen also nicht zufällig da. Sie erzählen Geschichten, sie verkörpern Werte: Dankbarkeit, Demut, Glaube, Gemeinschaft.
Die neue Gipfelgeneration: Selfie statt Stille
Doch in den letzten Jahren hat sich der Umgang mit dem Kreuz verändert. Statt ehrfürchtigem Staunen gibt es Turnübungen auf dem Querbalken. Kletteraktionen, bei denen Personen – gesichert oder nicht – auf dem Kreuz thronen, sich an den Streben hängen oder mit ausgestreckten Armen „Siegerposen“ einnehmen. Für den einen ein Adrenalinkick, für den anderen schlichtweg pietätlos.
Gerade in sozialen Medien kursieren tausende solcher Bilder. Mal inszeniert als „starker Moment“, mal bewusst grenzüberschreitend. Die Frage, ob man das eigentlich darf, stellt sich kaum noch – Hauptsache, das Bild wird viral. Dabei ist das Besteigen des Kreuzes nicht nur gefährlich, sondern auch respektlos gegenüber denen, die es errichtet haben – und gegenüber dem, wofür es steht.
Gefährdung, Entweihung, Ignoranz
Ein Gipfelkreuz ist kein Klettergerät. Es ist meist nicht dafür gebaut, das Gewicht eines Menschen zu tragen. Kletteraktionen können die Konstruktion beschädigen, Schrauben lockern, Fundamente lockern. Im schlimmsten Fall wird das Kreuz irreparabel zerstört – oder jemand kommt beim Versuch, sich in Szene zu setzen, zu Schaden.
Aber auch ohne physischen Schaden bleibt eine geistige Entwertung. Wer auf ein religiöses oder gedenkendes Symbol klettert, behandelt es wie ein Spielgerät. Für Angehörige von Verstorbenen oder für gläubige Menschen kann das verletzend sein. Und auch für die Ehrenamtlichen, die das Kreuz in mühsamer Arbeit aufgestellt haben, ist es ein Schlag ins Gesicht. Sie haben das Kreuz nicht gebaut, damit jemand daran herumturnt – sondern aus tiefem inneren Antrieb. Das zu übersehen, ist mehr als achtlos. Es ist ignorant.
Was bedeutet Respekt in den Bergen?
In der Natur unterwegs zu sein, bedeutet nicht nur körperliche Freiheit, sondern auch Verantwortung. Gegenüber der Landschaft, gegenüber anderen Bergsteigern – und gegenüber der Kultur, die diesen Raum geprägt hat. Gipfelkreuze sind Teil dieser Kultur. Wer sich daran stört, darf das sagen – und sich für alternative Symbole einsetzen. Doch das rechtfertigt keine Entweihung. Wer ein Symbol ablehnt, sollte es stehen lassen, nicht besteigen.
Gipfel ohne Kreuz – eine mögliche Alternative?
In manchen Regionen wird mittlerweile bewusst auf das Setzen eines Kreuzes verzichtet. Stattdessen gibt es Steinmännchen, Holzskulpturen oder einfach nur ein Gipfelbuch. Diese Entwicklung ist verständlich und Ausdruck einer pluralistischen Gesellschaft. Doch sie darf nicht aus Trotz gegenüber Traditionen entstehen, sondern aus bewusster Auseinandersetzung mit dem Symbol.
Fazit: Ein Kreuz – viele Bedeutungen. Aber eines ist sicher: Es ist kein Podest.
Gipfelkreuze sind Ausdruck eines tiefen kulturellen, oft auch spirituellen Zusammenhangs zwischen Mensch, Natur und Glauben. Wer auf einem Kreuz posiert, setzt ein Zeichen – aber oft nicht das, was er denkt. Statt Stärke zeigt sich Eitelkeit, statt Abenteuerlust Rücksichtslosigkeit. Die Berge lehren uns Demut, nicht Selbstdarstellung. Und wer das wirklich verstanden hat, braucht kein Selfie von ganz oben. Denn der Gipfel ist auch dann erreicht, wenn man mit beiden Füßen am Boden bleibt.
„Das Kreuz auf einem Berggipfel ist kein Kletterziel, sondern ein Zeichen der Stille – wer es mit Respekt betrachtet, hat den höchsten Punkt nicht nur körperlich, sondern auch innerlich erreicht.“
— Hansjörg Leitner, Alpenvereinsmitglied